Berechnung der optimalen Scanner-Auflösung
Die erforderliche Auflösung des Scanners wird in ppi (pixel per
inch) angegeben. Sie richtet sich nach
- Bildtyp (Strichzeichnung, Graustufenbild, Farbfoto)
- Maßstab (Verhältnis von Bildgröße zu
Originalgröße)
- Ausgabegerät (Bildschirm, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker
usw.)
- Qualitätsanforderung (auch zum Ausgleich unvermeidlicher
Scannerfehler)
Wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm oder auf einem
Thermosublimationsdrucker wiedergegeben, so muss stets mit einer Auflösung
gescannt werden, die der des Wiedergabegerätes entspricht. Denn jedes Pixel auf
dem Bildschirm oder im Sublimationsdruck kann das Farbsignal unverfälscht
wiedergeben.
Beim Bildschirm ist dies eine Auflösung von normalerweise 72 bis 100 ppi.
Sollen Fotos vor der Wiedergabe noch umfangreich bearbeitet werden, empfiehlt sich
eine um etwa 1/3 höhere Auflösung.
Beim Ausdruck auf Laser- oder Tintenstrahldruckern muss eine Besonderheit des
Druckvorgangs beachtet werden: Jeder Drucker kann nur einen schwarzen oder farbigen
Punkt (cyan, magenta oder gelb) setzen, je nach Druckerauflösung z. B. 600 dpi
(dots per inch). 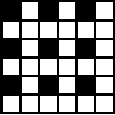
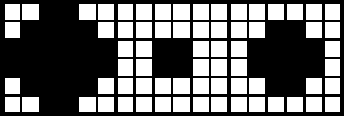 Zur Darstellung von Grautönen (oder Farbabstufungen) müssen
nun diese Punkte mehr oder weniger dicht sitzen oder mehr oder weniger groß
sein. Dazu muss das Bild in einzelne "Druckzellen" oder "Matrizen" zerlegt werden,
die nun selbst verschiedene Grautöne annehmen können. Solche Zellen sind
idealerweise 16 · 16 = 256 Pixel groß - entsprechend
der maximal möglichen 256 Graustufen, die ein Drucker darstellen kann. Damit
kann aber ein 600-dpi-Drucker nur noch 600 : 16 = 37,5
unterschiedliche "Zellen pro Inch" (in der Fachsprache: lpi = lines
per inch) darstellen. Ein feineres Raster z. B.
8 · 8 = 64 Pixel - also maximal 64 Graustufen - liefert
dann immerhin 600 : 8 = 75 lpi.
Zur Darstellung von Grautönen (oder Farbabstufungen) müssen
nun diese Punkte mehr oder weniger dicht sitzen oder mehr oder weniger groß
sein. Dazu muss das Bild in einzelne "Druckzellen" oder "Matrizen" zerlegt werden,
die nun selbst verschiedene Grautöne annehmen können. Solche Zellen sind
idealerweise 16 · 16 = 256 Pixel groß - entsprechend
der maximal möglichen 256 Graustufen, die ein Drucker darstellen kann. Damit
kann aber ein 600-dpi-Drucker nur noch 600 : 16 = 37,5
unterschiedliche "Zellen pro Inch" (in der Fachsprache: lpi = lines
per inch) darstellen. Ein feineres Raster z. B.
8 · 8 = 64 Pixel - also maximal 64 Graustufen - liefert
dann immerhin 600 : 8 = 75 lpi.
Somit muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen Rasterung des Bildes und Anzahl
der Graustufen.
Bei Postscriptdruckern lässt sich dieses Raster als "Rasterlaufweite" oder
"Halbtonfrequenz" bzw. kurz "Frequenz" frei einstellen. Standard sind Werte zwischen
60 und 70 lpi.
Tintenstrahldruckern darf man je nach Druckerauflösung eine Rasterlaufweite
zwischen 50 und 100 lpi unterstellen.
Der langen Rede kurzer Sinn: Zum Drucken macht es keinen Sinn,
eine höhere Farbtiefe als 8 Bit (256 Farb-/Graustufen) einzustellen und die
Scannerauflösung kann meist deutlich geringer als die Druckerauflösung
sein. Mehr als ca. 75 lpi und gleichzeitig ca. 64 Grautöne sind
realistischerweise nicht darstellbar.
Strichvorlagen auf Druckern
Für die Darstellung von Linien, schwarz-weiß oder in Farbe, wählt
man mindestens die Auflösung, die auch der Drucker liefern kann. Für
höchste Anforderungen wählt man eine um den Faktor 1,5 bis 2 höhere
Auflösung.
Graustufenbilder auf Laserdruckern
Eine kleine Rechnung ergibt für die optimale Scanauflösung (ppi):
ppi = lpi · V · Q, wobei
lpi = dpi / Wurzel(Zahl darstellbarer Graustufen)
V = gewünschte
Bildgröße / Originalgröße
Q = Qualitätsfaktor (Erfahrungswerte:
1,3 < Q < 1,7)
Farbphotos auf Tintenstrahldruckern
Die Rechnung für die optimale Scanauflösung ist die gleiche wie bei
Graustufenbildern. Lediglich der Qualitätsfaktor sollte etwas höher
gewählt werden (bis 2). Will man für jede der drei Farben Rot, Blau und
Grün 256 Abstufungen (8 Bit) beibehalten, muss man demnach mit
3 · 8 = 24 Bit einscannen.
(Die Grafiken und die Rechenbeispiele sind der Website von Stephan Hartl
entnommen.)
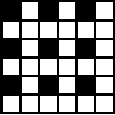
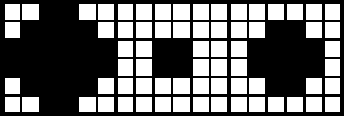 Zur Darstellung von Grautönen (oder Farbabstufungen) müssen
nun diese Punkte mehr oder weniger dicht sitzen oder mehr oder weniger groß
sein. Dazu muss das Bild in einzelne "Druckzellen" oder "Matrizen" zerlegt werden,
die nun selbst verschiedene Grautöne annehmen können. Solche Zellen sind
idealerweise 16 · 16 = 256 Pixel groß - entsprechend
der maximal möglichen 256 Graustufen, die ein Drucker darstellen kann. Damit
kann aber ein 600-dpi-Drucker nur noch 600 : 16 = 37,5
unterschiedliche "Zellen pro Inch" (in der Fachsprache: lpi = lines
per inch) darstellen. Ein feineres Raster z. B.
8 · 8 = 64 Pixel - also maximal 64 Graustufen - liefert
dann immerhin 600 : 8 = 75 lpi.
Zur Darstellung von Grautönen (oder Farbabstufungen) müssen
nun diese Punkte mehr oder weniger dicht sitzen oder mehr oder weniger groß
sein. Dazu muss das Bild in einzelne "Druckzellen" oder "Matrizen" zerlegt werden,
die nun selbst verschiedene Grautöne annehmen können. Solche Zellen sind
idealerweise 16 · 16 = 256 Pixel groß - entsprechend
der maximal möglichen 256 Graustufen, die ein Drucker darstellen kann. Damit
kann aber ein 600-dpi-Drucker nur noch 600 : 16 = 37,5
unterschiedliche "Zellen pro Inch" (in der Fachsprache: lpi = lines
per inch) darstellen. Ein feineres Raster z. B.
8 · 8 = 64 Pixel - also maximal 64 Graustufen - liefert
dann immerhin 600 : 8 = 75 lpi.